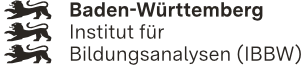Vortrag SCHULENTWICKLUNGSBEGLEITUNG UND DIE (UN)TIEFEN DES UNTERRICHTS (pdf)
Kurzbericht
Große Herausforderungen und innovative Lösungen verlangen, dass das gesamte Lehren und Lernen in den Blick genommen wird und sich zunehmend adaptiv an den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler orientiert. Dazu werden gelingende und professionell begleitete Schulentwicklungsprozesse benötigt, die in dieser Veranstaltung im Fokus standen.
Prof. Dr. Racherbäumer führte in die Bedeutung der Schulentwicklungsberatung (SEB) ein, indem sie aufzeigte, dass sie in Studien ein wichtiger Erfolgsfaktor für gelingende Schulentwicklungsprozesse sei. Vor allem Schulen an benachteiligten Standorten mit einem großen Handlungsdruck würden davon profitieren. Sie beurteilten die Unterstützung als positiv und konnten an Merkmalen, die als gelingend bei „effektiven“ Schulen an benachteiligten Standorten gelten, arbeiten, diese dort verbessern und für die Lernenden durch eine positivere Schulkultur letztlich mehr Unterrichtqualität erreichen. Es gebe jedoch dabei keinen Automatismus und SEB stoße auch auf Ablehnung: Schulentwicklungsberatung sei nicht gleich Schulentwicklungsberatung. Vor allem müsse eine Passung zwischen den spezifischen Bedarfen und Erwartungen der Schule und dem Angebot der SEB erreicht werden, damit sie als positiv wahrgenommen und zielgerichtet zu Veränderungen führen kann.
Dr. Joachim Herrmann reflektierte in seinem Impuls die Gelingensfaktoren der Hamburger Schulentwicklungsunterstützung für Schulen in wenig privilegierten Lagen. Seit Herbst 2024 begleitet das Angebot die Schulen des Startchancenprogramms.
Das Ziel der Schulentwicklungsbegleitung (SEB) sei letztlich die Verbesserung des Lernens der Schülerinnen und Schüler, damit diese ihre basalen Kompetenzen erreichten, um fit für ein gelingendes privates, gesellschaftliches und berufliches Leben zu werden. Herrmann betonte vor allem den Erwerb von Sprachkompetenzen im Unterricht als grundlegend, weil ohne sie keine anderen Inhalte und Problemlösekompetenzen entwickelt werden könnten. Insofern lasse sich eine Schulentwicklungsbegleitung nicht von Fragen der Unterrichtsentwicklung trennen. Strukturelle Entscheidungen und Prozesse bedürften in der Beratung einerseits der Hinterfragung ihrer Bedingungen, aber andererseits auch der Reflexion der Folgen durch den externen Blick. Nicht erfolgte Entscheidungen und Prozesse seien immer auch von ihren Auswirkungen für das Lernen der Kinder und Jugendlichen zu betrachten. Aus diesem Grund stelle sich die SEB in Hamburg im Tandem mit einem fachübergreifenden Didaktischen Training (DT) auf, das auf Unterrichtsebene die Lehrkräfte beratend, fortbildend, unterrichtsbegleitend unterstütze. Beide Elemente begleiteten die Schulen zusammen und beziehen sich gegenseitig aufeinander.
Wichtig für den langfristigen Begleitungsprozess sei es, die Schule als System zu verstehen, das seine Funktion auch behält, wenn die Personen sich ändern. So könne man von Einzelpersonen als erfolgreich oder scheiternd abstrahieren und z.B. den Unterricht aus seiner Funktion für einen gelingendes Lernen heraus mit Hilfe der externen Perspektive objektiver bearbeiten. In der gemeinsamen Reflexion könnten so gemeinsam didaktische Handlungsalternativen entwickelt werden, die adaptives Lernen für gelingende Lernprozesse ermöglichten.
Auf der Schulebene sei es sehr zielführend, Haltungen zu analysieren, denn sie prägten stark die Erwartungshaltung gegenüber Lernenden und somit das Lernklima, die Veränderungsbereitschaft und die Unterrichtsqualität. Die Änderung einer negativen Erwartungshaltung erreiche man dann etwa durch Änderung des Diskurses über die Lernenden, wenn z.B. mit Fokus darauf kommuniziert würde, wenn Lernende positiv überrascht hätten anstatt über Misserfolge zu berichten. Die Attribuierung von Misserfolg z.B. auf den außerschulischen Sozialraum der Lernenden helfe bei der Verbesserung des Lernens nicht, da es sich um für die Lehrkräfte nicht veränderbare Faktoren handele. Erklärungsmuster für mangelnden Erfolg sollten auf den Unterricht gewendet werden, da dieser von den Lehrkräften beeinflusst werden kann. Es gelte die didaktische Kompetenz der Lehrpersonen mit der Unterstützung der DT zu stärken. Herrmann führte den Erfolg dieser Tandems auch darauf zurück, dass diese Personen, die aus der Schulpraxis kommen, sehr gut ausgebildet und vorbereitet würden, um professionell zu handeln.
Diskussionsthemen:
- Chancen von Schulleitungen Haltungsänderungen anzustoßen, um die Kollegien für Änderungen in ihrem
Unterricht zu öffnen:
- Unterricht ins Gespräch bringen: über eigenen Misserfolg sprechen, um Rat fragen
- Kollegiales Feedback, Lesson Study anstoßen
- Zusammenarbeit mit Unterrichtsberatung der Fächer
- Inhaltliche Zusammenhänge von Schulleitungsausbildung und Schulentwicklungsbegleitung
- Langfristige Ermächtigung von Kollegien
- Weg von kleinen Veränderungen im Unterricht zu den grundlegenden Reformen
- Konkrete Fragen zu Ausbildung und Organisation der Tandems aus SEB und DT