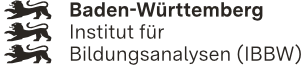Mit
- Peggy Eckert, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Bereich Demokratiebildung
- Vertr.-Prof. Dr. Matthias Forell, Universität Osnabrück, Institut für Erziehungswissenschaft
- Silke Donnermeyer, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung der Stadt Freiburg
- Thorsten Rendler, Referent für die Bildungsregion in der Stabsstelle Freiburger Bildungsmanagement
- Axel Rees, staatliches Schulamt Freiburg
- Silke Nitz, Schulleiterin Wentzinger Gemeinschaftsschule Freiburg
- Claudio De Bartolo, Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Arbeitsbereich Schulsozialarbeit
Kurzimpuls: Der Teilhabeatlas Kinder und Jugendliche (pdf 4,1 MB) als indikatorengestützter Gesprächsanlass über die Bildungs- und Teilhabechancen in unseren Städten und Landkreisen (Peggy Eckert, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Bereich „Demokratiebildung“)
Kurzimpuls: Schule als Sozialraum im Sozialraum (pdf) – Rolle und Bedeutung kommunaler Netzwerkstrukturen in der datenbasierten sozialraumorientierten Schulentwicklung (Vertr.-Prof. Dr. Matthias Forell, Universität Osnabrück, Institut für Erziehungswissenschaft)
Nutzungsrechte aller Materialien gemäß CC BY-NC-ND 4.0
Kurzbericht Impulse und Diskussion
Die Veranstaltung beleuchtete das Potenzial eines sozialraumorientierten, system- und professionsübergreifenden Zusammenwirkens von Schule, Schulaufsicht, Schulträger, kommunalem Bildungsmanagement und Jugendhilfe für die Verbesserung der Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen vor Ort. Die Bedeutung des Sozialraums rückte dabei auf mehreren Ebenen in den Blick: Auf der individuellen Ebene der Kinder und Jugendliche beeinflusst er maßgeblich deren jeweilige Bildungs- und Teilhabechancen. Auf der institutionellen Ebene stellt er eine zentrale Kategorie der Schulentwicklung und der Kooperation mit außerschulischen Partnern dar. Und schließlich bietet er auf der systemischen Ebene zahlreiche Möglichkeiten der engeren Verknüpfung von Kita, Schule, Jugendhilfe und außerschulischer Bildung im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft für die Bildung vor Ort. Das strukturelle Zusammenwirken der verschiedenen Systeme und Professionen entlang der Bildungsbiografie, wie es in Baden-Württemberg beispielsweise seit vielen Jahren in den Bildungsregionen praktiziert wird, kann hier eine wichtige Brückenfunktion einnehmen und Räume für die Verständigung und Kooperation eröffnen. Dazu brauchen die verschiedenen Akteurinnen und Akteure ein besseres Wissen über- und ein besseres Verständnis füreinander, aber auch ein kleinräumiges Wissen über das Sozialraumgefüge, über sozialstrukturelle Belastungsfaktoren und über Kooperationsmöglichkeiten und Hilfesysteme. Das Startchancen-Programm bietet viele Möglichkeiten, diese ressortübergreifende, multiperspektivische und multiprofessionelle Zusammenarbeit weiter auszubauen und strukturell zu verankern.
In Form von zwei moderierten Gesprächsrunden und zwei kurzen Impulsvorträgen brachte die Veranstaltung die Perspektiven von Wissenschaft und Praxis in einen gemeinsamen Dialog und zeigte anhand ausgewählter Beispiele auf, wie eine sozialraumorientierte, system- und professionsübergreifende Kooperation von Schule, Schulaufsicht, Schulträger, kommunalem Bildungsmanagement und Jugendhilfe gelingen kann.
Im moderierten Fachgespräch Teil 1 zu „Erfahrungen, Gelingensbedingungen und Bedarfe aus der Praxis“ gaben zunächst Silke Donnermeyer, Thorsten Rendler, Axel Rees, Silke Nitz und Claudio De Bartolo praxisnahe Einblicke in ihre bisherigen Erfahrungen mit der system- und professionsübergreifenden Zusammenarbeit von Schule, Schulaufsicht, Schulträger, kommunalem Bildungsmanagement und Jugendhilfe. Dabei gingen sie vor allem auf Gelingensfaktoren, Herausforderungen und Bedarfe aus Sicht der Praxis vor Ort ein und sprachen auch den durch die Kooperation entstehenden Mehrwert für alle Beteiligten an. Als Beispiele gelingender Praxis wurden unter anderem das Freiburger Gesprächsformat „Dialog im Dreieck“ zu gemeinsam getragenen Schulentwicklungsprozessen sowie die Tandem-Fortbildungen für Lehrkräfte und Fachkräfte der Schulsozialarbeit in Kooperation von Kommunalverband für Jugend und Soziales und Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung angesprochen. Es wurde deutlich, wie wesentlich eine von Vertrauen, Aufgeschlossenheit und gegenseitigem Verständnis geprägte Haltung ist, um trotz aller Unterschiede zwischen Systemen und Professionen als Verantwortungsgemeinschaft für die Bildung und das Aufwachsen vor Ort handeln zu können. Zudem scheint es zielführend, die strukturelle Verankerung von Schulsozialarbeit mit Blick auf den Sozialraum mehr in den Fokus zu rücken. Eine konzeptionell verankerte Kooperation ermöglicht zielorientiertes und abgestimmtes Handeln. Kooperation, so wurde deutlich, bedeutet zwar immer auch eine Investition von Zeit und Kraft, diese zahlt sich jedoch zum Wohle der Kinder so aus, dass gemeinsam Entwicklungen möglich werden, die keine Akteurin und kein Akteur alleine so voranbringen könnte.
Peggy Eckert, Leiterin des Standortes Sachsen der Deutschen Kinder und Jugendstiftung, stellte in ihrem Impulsvortrag den bundesweiten Teilhabeatlas Kinder und Jugendliche vor und ging dabei vor allem auf die spezifisch für Baden-Württemberg gewonnenen Erkenntnisse ein. Der Teilhabeatlas betrachtet die Lebensverhältnisse junger Menschen auf der Ebene der Stadt- und Landkreise anhand der Indikatoren Kinderarmut, Jugendarbeitslosigkeit, Ausbildungsplatzangebot, Betreuungsquote der Vorschulkinder, Schulabgänge ohne Abschluss, Anteil junger Menschen, Lebenserwartung, Erreichbarkeit lokaler Infrastruktur und Breitbandversorgung. Entlang der Indikatoren werden die Stadt- und Landkreise in Teilhabecluster eingeteilt, die detaillierte kartografische Darstellungen zu regionalen Unterschieden im Bundesgebiet und in den einzelnen Bundesländern erlauben. Ergänzend dazu wurden auch Kinder und Jugendliche sowie Fachkräften aus der Kinder- und Jugendarbeit in ausgewählten Stadt- und Landkreisen in Gruppengesprächen und qualitativen Interviews direkt befragt. Die qualitativen Ergebnisse spiegeln eindrücklich wider, wie junge Menschen selbst ihre Lebensverhältnisse und ihre Teilhabechancen wahrnehmen, welche Bedarfe sie haben und wo sie Potenziale und Handlungsansätze sehen. Zentrale Dimensionen für die Kinder und Jugendlichen waren vor allem Freizeitgestaltung, Selbstbestimmung und Beteiligung. Dabei spielen auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes und der Schule als Lern- und Lebensort eine wichtige Rolle. Peggy Eckert zeigte in ihrem Beitrag auf, wie sowohl die indikatorengestützten Analysen auf Ebene der Stadt- und Landkreise als auch die Befragung von jungen Menschen datenbasierte Aufschlüsse über die Teilhabechancen vor Ort geben und gute Gesprächsanlässe für die verantwortlichen Akteurinnen und Akteure bieten können.
Vertr.-Prof. Dr. Matthias Forell (Universität Osnabrück), Co-Leitung des Fokusmoduls zur diversitätssensiblen Aktivierung sozialraumbezogener Ressourcen im interdisziplinären Kompetenzzentrum Multiprofessionelle Schulentwicklung im Sozialraum im Rahmen des Startchancen-Programms, skizzierte in seinem Impulsvortrag ein Verständnis der Schule als Sozialraum im Sozialraum. Dabei nahm er Bezug auf die im Rahmen des Forschungsverbundes „Schule macht stark“ im Cluster für außerunterrichtliches Lernen und Sozialraumorientierung (ALSO) gewonnenen Erkenntnisse zur sozialraumorientierten Schulentwicklung und den dort entwickelten multiplen Belastungsindex. In einer Livedemonstration der im Rahmen von „Schule macht stark“ entwickelten ALSO-App wurde deutlich, wie Schulen und Kommunen die Indikatoren des multiplen Belastungsindex nutzen können, um sich einen anwendungsbezogenen kartografischen Überblick über die jeweiligen Sozialräume zu verschaffen und entsprechende Entwicklungsprozesse und Unterstützungsangebote auf den Weg zu bringen. Die zentralen Schlüsselindikatoren umfassen sozioökonomische, bildungsbezogene und sprachliche Dimensionen von Benachteiligung wie etwa Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Abiturquote, Quote an Personen ohne bzw. mit nicht anerkanntem Schulabschluss oder Anteil an Personen mit nicht-deutscher Familiensprache.
Im zweiten Teil des moderierten Fachgesprächs zu „Erfahrungen und Bedarfe der Praxis im Dialog mit den Erkenntnissen aus der Wissenschaft“ diskutierten Peggy Eckert, Vertr.-Prof. Dr. Matthias Forell, Silke Donnermeyer, Thorsten Rendler, Axel Rees, Silke Nitz und Claudio De Bartolo über mögliche Anknüpfungspunkte zwischen der im ersten Teil des Fachgesprächs angeklungenen Praxisperspektive und der wissenschaftlichen Perspektive aus den Kurzimpulsen. Die mögliche Nutzung der vorgestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse als Gesprächsanlass für die Praxis vor Ort war dabei ebenso Thema wie die Frage, welche Räume und Settings es dafür braucht und was ein kommunales Bildungsmanagement dazu beitragen kann, um die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit den vorgestellten Indikatoren kann dazu beitragen, die Bildungs- und Teilhabechancen an der eigenen Schule, im eigenen Sozialraum oder in eigenen Stadt- oder Landkreis besser einschätzen und passende Handlungsansätze für eventuell bestehende strukturelle Herausforderungen zu entwickeln. Sowohl der Erfahrungen aus der Praxis als auch die Erkenntnisse aus der Wissenschaft machten noch einmal eindrücklich deutlich, dass die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen und die Lebenswelten ihrer Lehrkräfte sich zum Teil erheblich voneinander unterscheiden (z. B. wenn Lehrkräfte nicht im sozialen Nahraum ihrer Schule leben) und es für die Gestaltung von Bildung daher von großer Bedeutung ist, die Lebenswelten junger Menschen zu verstehen und einzubeziehen. Im Austausch, der dann später auch für die Fragen und Impulse der Teilnehmenden geöffnet wurde, zeigte sich nochmals die große Bedeutung einer auf Vertrauen und gegenseitigem Verständnis basierenden Haltung aller Beteiligten. Für das Gelingen der system- und professionsübergreifenden Kooperation braucht es eine strukturelle Verankerung der Zusammenarbeit, Beständigkeit sowie Räume für den Austausch und zur gemeinsamen Entwicklung vor Ort passender Lösungen. Das kommunale Bildungsmanagement und das Startchancen-Programm bieten gute Chancen, um Entwicklungsprozesse auf der Systemebene strukturell gut zu gestalten.