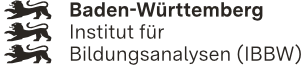Das IBBW hat im Frühjahr 2024 erstmalig die Zentralen Erhebungen (Online-Befragung von Schülerinnen und Schülern zum „Schulklima“) an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg durchgeführt. Etwa 25 Prozent aller beruflichen Schulen haben teilgenommen. Im Frühjahr 2025 fand der zweite Durchgang an beruflichen Schulen statt, diesmal mit 101 teilnehmenden Schulen. Damit hat sich die Teilnahmequote auf über 36 Prozent erhöht.
Im Jahr 2026 werden die Zentralen Erhebungen im Zeitraum vom 23. Februar bis zum 27. März 2026 durchgeführt. Befragt werden alle Eingangsklassen der teilnehmenden Schulen.
Die Befragung findet online statt. Der Aufwand für die Schulen ist gering. Das IBBW verarbeitet die Daten anonymisiert, d. h. ohne Kennzeichnung der Schülerinnen und Schüler bzw. der Lehrkräfte.
An den beruflichen Schulen werden in diesem Schuljahr die Schülerinnen und Schüler der Eingangsklassen zum Schulklima sowie zur wahrgenommenen Unterrichtspraxis im Fach Mathematik befragt.
Die wahrgenommene Unterrichtspraxis im Fach Mathematik wird in den Dimensionen „Strukturierte Klassenführung“,
„Kognitive Aktivierung“ und „Konstruktive Unterstützung“ erfasst. Diese drei Dimensionen setzen sich jeweils
aus zwei bis drei Teildimensionen zusammen, zu denen die Fachlehrkräfte detaillierte Rückmeldungen erhalten.
Selbstverständlich betrifft die Befragung zur wahrgenommenen Unterrichtspraxis im Fach Mathematik nur die Eingangsklassen, in denen
das Fach unterrichtet wird. Der Fragebogen zum Schulklima mit der Befragung zur wahrgenommenen Unterrichtspraxis im Fach Mathematik kann hier
eingesehen werden.
Das Schulklima nimmt die von Prof. em. Dr. Ebner entwickelten Dimensionen „Akzeptanz, Respekt, Unterstützung durch die Lehrperson“, „Ausstattung, Sicherheit, Sorgfalt“, „Ausgrenzung, Gefährdung durch Peers“, „Akzeptanz, Respekt, Vertrauen unter den Schülerinnen und Schülern“ sowie die zwei Einzelitems „Ich glaube, dass die Lehrpersonen unserer Schule gut miteinander arbeiten“ und „Insgesamt finde ich unsere Schule ziemlich gut“ in den Fokus. Der Fragebogen kann hier eingesehen werden.
Weiterführende Erklärungen und Antworten auf häufige Fragen finden Sie in den FAQs zu organisatorisch-technischen
Fragen und zu inhaltlichen
Fragen. Darüber hinaus steht eine Musterauswertung
zum Download bereit.
Organisatorisch-technische Fragen und Antworten
Nach Schulgesetz (§ 114) und Verordnung des Kultusministeriums über die Zentralen Erhebungen zur Schul- und Unterrichtsqualität (ZE VO) vom 29. Januar 2026 sind die Zentralen Erhebungen an beruflichen Schulen verpflichtend durchzuführen.
Der Befragungszeitraum startet am 23. Februar 2026 und endet am 27. März 2026.
Spätestens eine Woche vor Beginn des Befragungszeitraums werden die Befragungslinks an die E-Mail-Adresse der Schulleitung (poststelle@[Dienststellennummer].schule.bwl.de) versendet. In diesem Zusammenhang kann es erforderlich sein, den Spam-Ordner zu prüfen, da die E-Mails aus der Befragungssoftware generiert werden.
Die Erhebung wird im Unterricht durchgeführt.
Ja, für die Durchführung benötigen die Schülerinnen und Schüler ein digitales Endgerät mit Internetzugang.
Die Lehrkraft leitet den Schülerinnen und Schüler den klassenspezifischen Link zur Befragung weiter, sodass sie im Unterricht an der Befragung teilnehmen können.
Die Befragung findet in den Eingangsklassen statt. Um aussagekräftige Daten zu gewinnen, müssen alle Eingangsklassen teilnehmen.
Nein, die Befragung ist auf die Eingangsklassen bezogen. Dies ist notwendig, damit sich Vergleichswerte (z. B. im Schuldatenblatt) auf eine eindeutig definierte Gruppe beziehen.
Wenn weniger als drei Personen einer Klasse teilnehmen, werden die Daten aus Datenschutzgründen nicht ausgewertet. Es wird keine Ergebnisrückmeldung erstellt.
Der Zeitrahmen für die Durchführung von Zentralen Erhebungen mit Schülerinnen und Schülern umfasst eine Schulstunde.
Ja, die Fragebögen werden als PDF-Version veröffentlicht.
Ansicht der Onlinebefragung der Zentralen Erhebungen 2026 (wahrgenommene Unterrichtspraxis)
Ansicht der Onlinebefragung der Zentralen Erhebungen 2026 (Schulklima)
Bitte beachten Sie, dass dies Ansichtsexemplare sind, die nicht zur Durchführung der Zentralen Erhebungen in den Klassen verwendet werden können.
Ja, die Aussagen wurden in Bezug auf das Verständnis validiert. Um das Verständnis zu erleichtern, können die Aussagen bei Bedarf während der Durchführung vorgelesen werden. Nachfragen von Schülerinnen und Schülern dürfen beantwortet werden. Dabei sollten Begriffe verwendet werden, die den Schülerinnen und Schülern geläufig sind, ohne konkrete Beispiele zu geben.
Die Schulleitung bekommt die Ergebnisse nach Abschluss des Befragungszeitraums zugesandt.
Diese enthält eine zusammenfassende Auswertung auf Bildungsgangebene sowie klassenspezifische Auswertungen zur Weiterleitung an die betreffenden Lehrkräfte der Klasse. Die Klassenleitung erhält die Auswertung zum Schulklima, die Fachlehrkraft die Auswertung zur wahrgenommenen Unterrichtspraxis.
Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Daten der Schule außerdem zusammengefasst im Schuldatenblatt dargestellt.
Die Daten aus der Befragung stehen vom IBBW aufbereitet für das kommende Statusgespräch zur Verfügung und können mit der Schulaufsicht im Zusammenhang mit anderen Daten im Schuldatenblatt besprochen werden.
In diesem Fall kann die Befragung auch individuell durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Link zur Befragung ihrer Klasse per E-Mail von ihrer Klassenlehrkraft.
Dafür kann die folgende E-Mail-Vorlage verwendet werden:
Liebe Schülerinnen und Schüler,
derzeit finden die Zentralen Erhebungen an allen beruflichen Schulen in Baden-Württemberg statt. Es werden alle Eingangsklassen zu zentralen Aspekten befragt:
- Schulklima
- wahrgenommene Unterrichtspraxis im Fach Mathematik
(sofern die Klasse im Fach Mathematik unterrichtet wird)
Die Teilnahme an der Befragung ist verpflichtend.
Bitte nehmen Sie mit dem Link im Anhang bis spätestens 27. März 2026 teil.
Hinweise zur Befragung:
- Die Befragung ist anonym.
- Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
- Die Befragung muss durch einen Klick auf das Feld „Absenden“ abgeschlossen werden.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Inhaltliche Fragen und Antworten
Das Schulklima visualisiert die Einschätzung aller Schülerinnen und Schüler einer Klasse zu den von Prof. em. Dr. Ebner entwickelten Dimensionen „Akzeptanz, Respekt, Unterstützung durch die Lehrperson“, „Ausstattung, Sicherheit, Sorgfalt“, „Ausgrenzung, Gefährdung durch Peers“, „Akzeptanz, Respekt, Vertrauen unter den Schülerinnen und Schülern“ sowie zu den zwei Einzelitems „Ich glaube, dass die Lehrpersonen unserer Schule gut miteinander arbeiten“ und „Insgesamt finde ich unsere Schule ziemlich gut“. So werden vorhandene Stärken bzw. Verbesserungspotentiale bewusst. Ein gutes Schulklima fördert den Lernerfolg.
Falls solche Probleme existieren, breiten sich diese durch Verschweigen oder Ignorieren eher noch aus. Informelle Machtstrukturen (wie sie z. B. beim Mobbing existieren) sind erst bearbeitbar, wenn Sie im Bewusstsein aller Klassenmitglieder sind und eine Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler zur Verbesserung angebahnt wird.
Ein gutes bzw. verbessertes Klassenklima, fördert die Lehrer-Schüler-Beziehung und wirkt somit für die Lehrperson nachweislich als Resilienzfaktor. Lehrpersonen, die meinen ein gutes Klima zu fördern bzw. es verbessern zu können, nehmen sich selbstwirksam wahr.
Klassenbezogene Ergebnisse
Nach der Befragung erhalten die Schulen ihre Ergebnisse je Klasse auf einer Seite als .pdf-Dokument. Diese werden von der Schule an die jeweiligen Klassenlehrkräfte weitergeleitet, die die Ergebnisse mit ihrer Klasse besprechen.
Bildungsgangbezogene Ergebnisse
Die Daten zum Schulklima werden in aggregierter Form (bildungsgangbezogen) im Schuldatenblatt ganzheitlich in den Blick genommen, um diese für die Statusgespräche im Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarungen sichtbar zu machen. Dabei werden Referenzwerte (Wert der gesamten Schule im Vergleich zum jeweiligen Bildungsgang) dargestellt.
Grundsätzlich sollten die Ergebnisse den befragten Klassen immer zurückgemeldet werden.
Die Bildungsforschung hat die Erfahrungen aus der Schulpraxis bestätigt, wie wertvoll Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler sind. Die Daten schaffen Gesprächsanlässe und können Hinweise zur Weiterentwicklung von Schule und Unterricht liefern und somit zum Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler beitragen. Hier finden Sie mögliche Leitfragen für das Rückmeldegespräch mit der Klasse.
Eine Bewertung der Lehrkraft als Person ist damit ausdrücklich nicht verbunden.
Je nach Schulart und Bildungsgang, sowie der “klimatischen Ausgangslage” scheinen 20 bis 45 Min für die Ergebnisdarstellung und gemeinsame Besprechung (vgl. Leitfragen) und schriftliches Festhalten der vereinbarten Maßnahmen als angemessen.
Alle Klassendurchschnitte einer Schule werden vom niedrigsten bis zum höchsten Wert aufgereiht und in vier gleich große Bereiche, die sogenannten Quartile, eingeteilt. Im oberen Quartil sind die 25% der Klassen mit den höchsten Werten, im unteren Quartil sind die 25% der Klassen mit den niedrigsten Werten und dazwischen werden die beiden mittleren Quartile zusammengefasst. Sie ergeben 50%.
Die am ZSL eingerichtete Arbeitsgruppe DGSE bietet den Schulen umfangreiche Unterstützung. Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich bitte an: support@dgse.digital oder melden sich direkt im LFB-Online unter .https://lfbo.kultus-bw.de/lfb/termine/VXQV8 zu einer Veranstaltung an.
Kontakt für weitere Fragen
Arbeitsgruppe DGSE am ZSL
support@dgse.digital