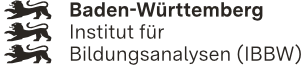Die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit erwerben, die Noten, die sie bekommen, der Besuch eines Gymnasiums - all das hängt nicht nur von den individuellen Fähigkeiten der Lernenden ab, sondern auch davon, wie gut sie von ihrer Familie und ihrem sozialen Umfeld beim Lernen unterstützt werden können. Der Bildungserfolg hängt also auch von der sozialen Herkunft ab.
Kinder und Jugendliche, die in einem sozialen Umfeld aufwachsen, dem es an Geld, Bildung oder gesellschaftlicher Teilhabe mangelt - die also sozio-ökonomisch benachteiligt sind - verteilen sich nicht gleichmäßig auf die Schulen in Baden-Württemberg. Entsprechend unterscheiden sich die Schulen mit Blick auf die sozio-ökonomische Zusammensetzung ihrer Schülerschaft und die damit verbundenen Anforderungen, für Ausgleich zu sorgen.
Der Schulsozialindex BW macht diese Unterschiede datenbasiert und landesweit vergleichbar sichtbar. Zur Berechnung werden Kriterien herangezogen, die sich nachweislich auf den Bildungserfolg auswirken, jedoch nicht im Einflussbereich der einzelnen Schule liegen. Der Schulsozialindex kann also genutzt werden, um Schulen mit einer sozio-ökonomisch benachteiligten Schülerschaft zu identifizieren und gezielt zu unterstützen. Er sagt jedoch nichts über die pädagogische Arbeit der Schulen aus.
FAQs zum Schulsozialindex
Der Koalitionsvertrag 2021-2026 der Landesregierung sieht den Einstieg in eine sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung vor - beginnend bei den Grundschulen. Vor diesem Hintergrund hat das IBBW im Rahmen eines Modellversuchs zur sozialindexbasierten Ressourcenzuweisung zunächst einen vorläufigen Schulsozialindex für öffentliche Grundschulen in Baden-Württemberg entwickelt.
Vor dem Hintergrund der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Umsetzung des Startchancen-Programms, die eine wissenschaftsgeleitete Auswahl der Schulen fordert, hat das IBBW für alle öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg einen Schulsozialindex entwickelt. In diesem Zuge wurde auch der Schulsozialindex für Grundschulen aktualisiert.
Die Kriterien, die dem Schulsozialindex zugrunde liegen, unterscheiden sich teilweise in Abhängigkeit von der Schulartgruppe (s. auch FAQ "Was ist eine Schulartgruppe?").
Für Grundschulen fließen die folgenden Kriterien in die Berechnung des Schulsozialindex ein:
- Anteil der Kinder und Jugendlichen in Bedarfsgemeinschaften am Wohnort der Schülerinnen und Schüler
- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mehr als 100 Büchern im Haushalt
- durchschnittliche Kaufkraft im Schulbezirk
- Anteil der Haushalte ohne Schulabschluss im Schulbezirk
Für allgemeinbildende weiterführende Schulen ohne Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) fließen die folgenden Kriterien in die Berechnung des Schulsozialindex ein:
- Anteil der Kinder und Jugendlichen in Bedarfsgemeinschaften am Wohnort der Schülerinnen und Schüler
- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mehr als 100 Büchern im Haushalt
- durchschnittlicher Kompetenzmittelwert in Lernstand 5
Für SBBZ und berufliche Schulen fließen die folgenden Kriterien in die Berechnung des Schulsozialindex ein:
- Anteil der Kinder und Jugendlichen in Bedarfsgemeinschaften am Wohnort der Schülerinnen und Schüler
- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
Die Berechnung des Schulsozialindex erfolgt in drei Schritten:
- Kodierung der Kriterien
Jedes Kriterium wird auf Basis seiner Spannweite (Abstand zwischen kleinstem und größtem Wert) in fünf gleich große Segmente eingeteilt. Dabei werden Extremwerte bzw. Ausreißer nicht berücksichtigt. Den Segmenten werden Werte („Kodierungen“) zwischen 1 und 5 zugewiesen, wobei höhere Werte eine stärkere sozio-ökonomische Benachteiligung bedeuten. Für jedes Kriterium, das für eine Schule vorliegt, erhält die Schule eine Kodierung.
- Berechnung des Indexwerts
Für jede Schule wird der Indexwert als Mittelwert ihrer Kodierungen berechnet. Die Kriterien fließen dabei gleichgewichtet (mit einem Gewicht von 1) ein.
- Zuweisung zu Indexstufen
Auf Basis der Spannweite der Indexwerte werden sieben gleich große Segmente gebildet - die Indexstufen. Den Indexstufen werden Werte zwischen 1 und 7 zugewiesen, wobei höhere Werte eine stärkere sozio-ökonomische Benachteiligung bedeuten. Jede Schule wird entsprechend ihrem Indexwert einer der sieben Indexstufen zugewiesen.
Die beschriebene Vorgehensweise bei der Berechnung orientiert sich an der Berliner Schultypisierung.
Es gibt für alle öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen einen Schulsozialindex. Allerdings fließen je
nach Schulart teil unterschiedliche Kriterien in die Berechnung ein, sodass die Indexstufen der Schulen nur innerhalb der folgenden
Schulartgruppen vergleichbar sind:
- Grundschulen
- Allgemeinbildende weiterführende Schulen ohne Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
- SBBZ und berufliche Schulen
Zwischen diesen Schulartgruppen ist ein Vergleich der Indexstufen derzeit nicht möglich.
Eine Schulartgruppe fasst solche Schularten zusammen, für die dieselben Kriterien zur Berechnung des Schulsozialindex vorliegen. Innerhalb einer Schulartgruppe sind Vergleiche auf Basis des Schulsozialindex möglich, zwischen Schulartgruppen nicht. Folgende Schulartgruppen und -arten werden unterschieden:
Grundschulen
- Grundschulen
- Grundschulen in Verbund mit einer Gemeinschaftsschule
Allgemeinbildende weiterführende Schulen ohne Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
- Gemeinschaftsschulen (Sekundarstufe I und II)
- Gymnasien
- Realschulen
- Schulen besonderer Art
- Werkreal-/Hauptschulen
SBBZ und berufliche Schulen
- SBBZ mit dem Förderschwerpunkt (FSP) Emotionale und soziale Entwicklung
- SBBZ mit dem FSP Geistige Entwicklung
- SBBZ mit dem FSP Hören
- SBBZ mit dem FSP Kranke in längerer Krankenhausbehandlung
- SBBZ mit dem FSP Körperliche und motorische Entwicklung
- SBBZ mit dem FSP Lernen
- SBBZ mit dem FSP Sehen
- SBBZ mit dem FSP Sprache
- Berufliche Schulen (BS) mit Bildungsgängen der Berufsausbildung entsprechend Sektor I der integrierten Ausbildungsberichterstattung (iABE)
- BS mit Bildungsgängen der Berufsvorbereitung entsprechend Sektor II der iABE
- BS mit Bildungsgängen zum Erwerb der Hochschulreife entsprechend Sektor III der iABE
Für die Wohnorte der Schülerinnen und Schüler wird zunächst jeweils der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften berechnet.
Die Wohnorte entsprechen dabei den Postleitzahl-Ort-Ortsteilgebieten.
Bei der Berechnung des Anteils wird auf Daten der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen. Eine Bedarfsgemeinschaft (BG) „bezeichnet eine Konstellation von Personen, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften. Von jedem Mitglied der BG wird erwartet, dass es sein Einkommen und Vermögen zur Deckung des Gesamtbedarfs aller Angehörigen der BG einsetzt (Ausnahme: Kinder). […] Eine BG (gem. § 7 SGB II) hat mindestens einen Leistungsberechtigten.“ (vgl. Glossar der Statistik der BA).
Bei der Berechnung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren werden alle Kinder im Umfeld von leistungsberechtigten Personen nach dem SGB II berücksichtigt. Der Anteil gibt für Kinder und Jugendliche das Risiko an, aktuell in einem Haushalt zu leben, in dem Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II vorliegt.
Pro Schule wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus den jeweiligen Wohnorten mit dem dortigen Anteil der Kinder in Bedarfsgemeinschaften multipliziert, die Produkte werden aufaddiert und an der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an der Schule relativiert.
In der amtlichen Schulstatistik wird der Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler entsprechend der Definition zur Schulstatistik der Kultusministerkonferenz erfasst. Demnach ist „ein Migrationshintergrund anzunehmen, wenn mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft:
- Keine deutsche Staatsangehörigkeit,
- Nichtdeutsches Geburtsland,
- Nichtdeutsche Verkehrssprache in der Familie bzw. im häuslichen Umfeld (auch wenn der Schüler/die Schülerin die deutsche Sprache beherrscht).“
Für das Kriterium wird der durchschnittliche Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in den letzten vier Schuljahren herangezogen.
Die Daten, die dem Kriterium zugrunde liegen, stammen aus den jährlich verpflichtend stattfindenden Lernstandserhebungen VERA 3 und VERA 8. Darin schätzen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ein, wie viele Bücher es bei ihnen zuhause gibt.
Für das Kriterium wird der durchschnittliche Anteil der an VERA 3 bzw. VERA 8 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit mehr als 100 Büchern im Haushalt über die VERA-Durchgänge der letzten vier Schuljahre herangezogen.
Die Daten, die dem Kriterium zugrunde liegen, stammen von einem kommerziellen Anbieter und wurden auf Ebene der Schulbezirke der Grundschulen ausgewertet.
Die Daten, die dem Kriterium zugrunde liegen, stammen von einem kommerziellen Anbieter und wurden auf Ebene der Schulbezirke der Grundschulen ausgewertet.
Die Daten, die dem Kriterium zugrunde liegen, stammen aus der jährlich verpflichtend stattfindenden Lernstandserhebung Lernstand 5.
Für das Kriterium wird der durchschnittliche Kompetenzwert der Schülerinnen und Schüler über die Bereiche Deutsch - Leseverständnis und Mathematik - Operations- und Zahlverständnis in den Durchgängen der letzten vier Schuljahre gemittelt.
Kontakt
Dr. Merle Steinwascher
schulsozialindex@ibbw.kv.bwl.de