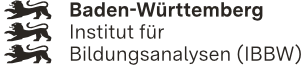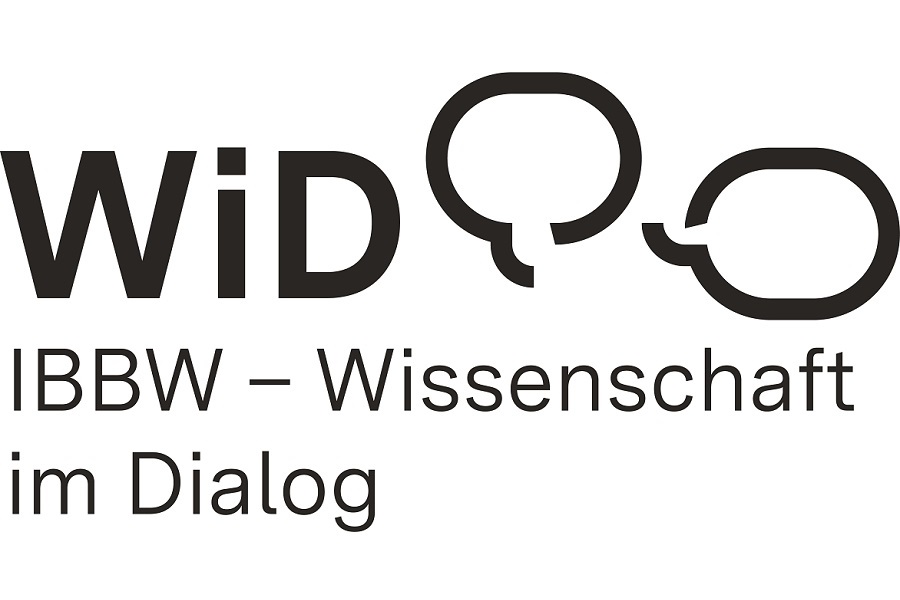
Die Veranstaltung beleuchtet, wie die verschiedenen Institutionen und Professionen, die sich vor Ort um die Bildung, die Entwicklung und
das Aufwachsen junger Menschen kümmern, nachhaltig zusammenwirken können. Ziel ist es, dass sie Kinder und Jugendliche und deren
Familien entlang der gesamten Bildungsbiografie möglichst ganzheitlich betrachten. So können sie ihnen dann passgenaue Bildungs-
und Unterstützungsangebote machen.
Zwei kurze wissenschaftliche Impulse zum „Teilhabeatlas Kinder und Jugendliche“ und zu einem „multiplen
Benachteiligungsindex“ werden eingerahmt von einem zweiteiligen Fachgespräch, in dem Erkenntnisse und Bedarfe aus Wissenschaft
und Praxis zusammengeführt werden.
Im Rahmen ihres Verantwortungsbereichs machen sich viele Kommunen Gedanken darüber, wie sie benachteiligte Kinder und
Jugendlichen durch zusätzliche Angebote unterstützen können.
Auch in Prozessen der Schulentwicklung rückt der Sozialraum zunehmend als zentrale Kategorie in den Blick, aktuell
besonders im Rahmen des Startchancen-Programms.
Für eine gelingende Kooperation brauchen die verschiedenen Akteurinnen und Akteure ein besseres Wissen über- und ein besseres
Verständnis füreinander, aber auch Wissen über den Sozialraum und die dortigen kleinräumigen Netzwerkstrukturen und
Hilfesysteme. Im Startchancen-Programm ist die engere Abstimmung von Schulen, Schulträgern, Schulaufsicht und
Jugendhilfe strukturell angelegt. Das kommunale Bildungsmanagement, wie es z. B. in Baden-Württemberg seit vielen Jahren in den
Bildungsregionen praktiziert wird, kann hier eine wichtige Brückenfunktion einnehmen. Räume für eine system- und
professionsübergreifende Verständigung können damit geschaffen werden.
Programm:
Moderiertes Fachgespräch Teil 1 – Erfahrungen, Gelingensbedingungen und Bedarfe aus der Praxis
- Wie gestalten wir eine system- und professionsübergreifende Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Schule, Schulaufsicht, Schulträger und Jugendhilfe?
- Was braucht es zum guten Gelingen?
- Wie profitieren wir in unseren jeweiligen Systemen davon?
- Welche Erfahrungen haben wir bereits gemacht, auf die wir im Startchancen-Programm aufbauen können?
Dr. Susanne Zeller (Institut für Bildungsanalysen-Baden-Württemberg, Leiterin der Beratungsstelle für das Landesprogramm
Bildungsregionen) im Gespräch mit
Silke Donnermeyer (Leitung Amt für Schule und Bildung, Freiburg), Thorsten Rendler (Referent für die Bildungsregion in der
Stabsstelle Freiburger Bildungsmanagement), Axel Rees (Staatliches Schulamt Freiburg), Silke Nitz (Schulleiterin Wentzinger
Gemeinschaftsschule) und Claudio De Bartolo, (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Arbeitsbereich
Schulsozialarbeit).
Kurzimpuls aus der Wissenschaft 1 – Der „Teilhabeatlas Kinder und Jugendliche“ als indikatorengestützter
Gesprächsanlass über die Bildungs- und Teilhabechancen in unseren Städten und Landkreisen (Peggy Eckert, Deutsche
Kinder- und Jugendstiftung, Bereich „Demokratiebildung“)
Der erst kürzlich erschienene Teilhabeatlas ist eine gemeinsame Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung,
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Wüstenrot Stiftung. Anhand ausgewählter Indikatoren wie z. B. Kinderarmut,
Schulabbruchsquote, Jugendarbeitslosigkeit, Ausbildungsplatzangebot, Lebenserwartung oder räumliche Erreichbarkeit von Angeboten gibt
er einen Einblick in die Lebensverhältnisse und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Die bundesweite Betrachtung aller Stadt-
und Landkreise in Deutschland kartografischen Darstellungen zeigt die zum Teil erheblichen regionale Unterschiede. Aber auch die
Lebensverhältnisse und Teilhabechancen junger Menschen in den einzelnen Regionen Baden-Württembergs lassen deutliche Unterschiede
erkennen. Ergänzend zu den indikatorengestützten Analysen wurden Kinder und Jugendliche, Fachkräfte der Sozialen Arbeit,
Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendämter und die Kommunalpolitik in ausgewählten Stadt- und Landkreisen auch direkt
befragt. Gemeinsame Erkundungen des Lebensumfeldes und qualitative Interviews spiegeln eindrücklich wider, wie junge Menschen selbst
ihre Lebensverhältnisse und Teilhabechancen wahrnehmen, welche Bedarfe sie haben und wo sie Potenziale und Handlungsansätze
sehen. Unter anderem spielt dabei auch die Gestaltung der Schule als Lern- und Lebensort eine wichtige Rolle. Peggy Eckert wirft in ihrem
Impuls ein Schlaglicht darauf, wie die Erkenntnisse aus dem Teilhabe-atlas und die sich daraus ergebende Handlungsempfehlungen als
Gesprächsanlass für die gemeinsame Arbeit an der Verbesserung der Bildungs- und Teilhabechancen junger Menschen dienen
können.
Zur Person:
Peggy Eckert leitet den Standort Sachsen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Demokratiebildung, Kinder-
und Jugendbeteiligung und Engage-mentförderung. Seit vielen Jahren engagiert sie sich in den verschiedenen Programmen der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung zur Demokratieförderung in Kita, Schule und Kommune. Als Kindheitswissenschaftlerin ist sie Expertin
für die außerschulische Bildung und die Teilhabebedürfnisse von Kindern und Jugendlichen.
Kurzimpuls aus der Wissenschaft 2 – Schule als Sozialraum im Sozialraum – Rolle und Bedeutung kommunaler
Netzwerkstrukturen in der datenbasierten sozialraumorientierten Schulentwicklung (Vertr.-Prof. Dr. Matthias Forell,
Universität Osnabrück, Institut für Erziehungswissenschaft)
Für die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen spielt das Milieu, in dem sie aufwachsen, eine maßgebliche
Rolle. Aber auch für die Gestaltung von schulischer Bildung ist das sozialräumliche Umfeld ein wichtiger Faktor. Es wirkt sich
nicht nur auf die (Lebens-)Themen aus, die die Kinder und Jugendlichen mit in die Schule bringen, sondern auch auf die Möglichkeiten,
die eine Schule in ihrer eigenen Entwicklung hat, beispielsweise in der Kooperation mit außerschulischen Lernorten und im Einbezug
externer Partner. Um Kinder und Jugendliche in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozessen möglichst passgenau zu unterstützen,
brauchen die verschiedenen Beteiligten in Schule und Kommune etc. daher ein kleinräumiges Wissen über das Sozialraumgefüge,
über sozialstrukturelle Belastungsfaktoren, aber auch über Kooperationsmöglichkeiten und Hilfesysteme. Matthias Forell gibt
einen Einblick, wie kommunale Netzwerk- und Koordinierungsstrukturen zu einer sozialraumbasierten Bildungsplanung beitragen,
Schulentwicklungsprozesse unterstützen und die Zusammenarbeit im Sozialraum fördern können. Ein so genannter multipler
Benachteiligungsindex, der unterschiedliche Hintergrundmerkmale von Schülerinnen und Schülern miteinander verzahnt, kann dazu
hilfreiches Steuerungswissen generieren und Gesprächsanlässe schaffen, um gemeinsam zielgerichtete
Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln.
Zur Person:
Dr. Matthias Forell hat an der Universität Osnabrück die Vertretungsprofessur für Schulpäda-gogik mit dem Schwerpunkt
Diversität und Teilhabe inne. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören die sozialraumorientierte Schulentwicklung, soziale
Ungleichheit im deutschen Schulsystem, Bildungsübergänge und Bildungsgerechtigkeit sowie Bildung in der Krise. Im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung des Startchancen-Programms ist er als Co-Leitung des Fokusmoduls zur diversitätssensiblen Aktivierung
sozialraumbezogener Ressourcen im interdisziplinären Kompetenzzentrum Multiprofessionelle Schulentwicklung im Sozialraum (IKOM
Räume) beteiligt. Zuvor koordinierte er das Cluster „Außerunterrichtliches Lernen und Sozialraumorientierung (ALSO)“
im Forschungsverbund „Schule macht stark! (SchuMaS)“.
Moderiertes Fachgespräch Teil 2 – Erfahrungen und Bedarfe der Praxis im Dialog mit den Erkenntnissen aus der
Wissenschaft
- Wie können wir vor Ort die vorgestellten Erkenntnisse aus der Wissenschaft als Ge-sprächsanlässe mit unseren Partnerinnen und Partnern nutzen?
- Wo können wir gemeinsam noch genauer hinschauen, um die Bildungs- und Teilha-bechancen unserer Kinder und Jugendlichen vor Ort zu verbessern?
- An welchen Punkten können wir gemeinsam ansetzten und zusammenwirken?
Dr. Susanne Zeller im Gespräch mit Peggy Eckert, Vertr.-Prof. Dr. Matthias Forell, Silke Don-nermeyer, Thorsten Rendler, Axel Rees, Silke Nitz, Claudio De Bartolo
Öffnung des Fachgesprächs für alle Teilnehmende
Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen, Fragen und Ideen zum Thema im offenen Austausch!
Informationen zur Veranstaltung
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 06.11.2025 von 15.00 – 17.00 Uhr online mit Webex statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine
Anmeldung bis zum
04.11.2025 ist erforderlich.
Den Teilnahmelink erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung per Mail.
Die Veranstaltung ist eine der Aktivitäten des IBBW im Bereich Wissenschaftstransfer und findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „IBBW - Wissenschaft im Dialog“ statt.
Kontakt
IBBW - Referat 43: Entwicklung von Standards, Wissenschaftstransfer
Nicole Stein
nicole.stein@ibbw.kv.bwl.de
Dr. Alexandra Dehmel
alexandra.dehmel@ibbw.kv.bwl.de